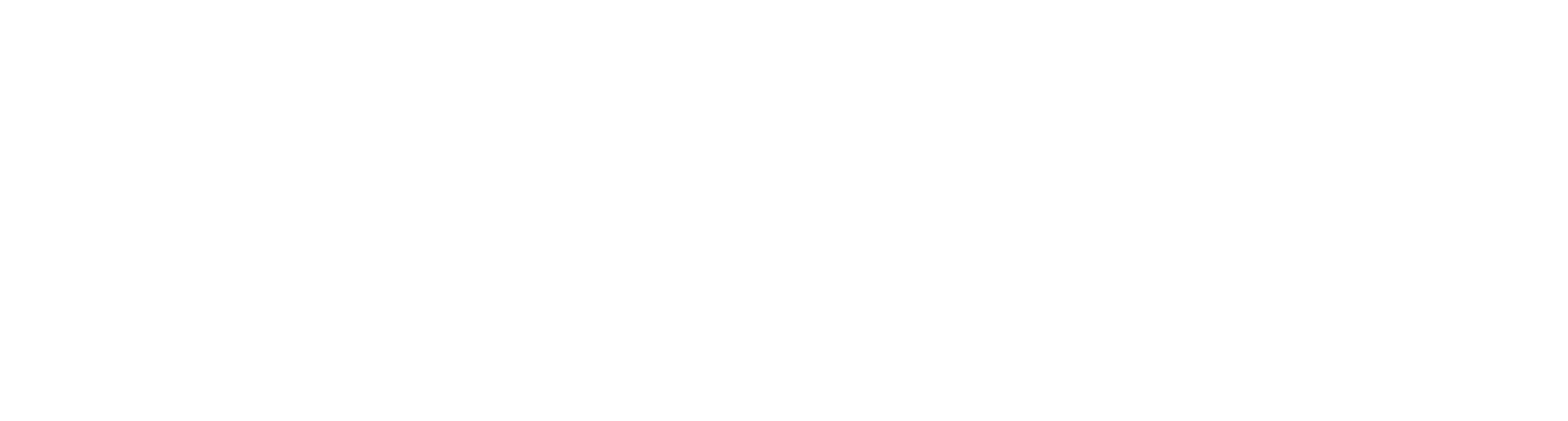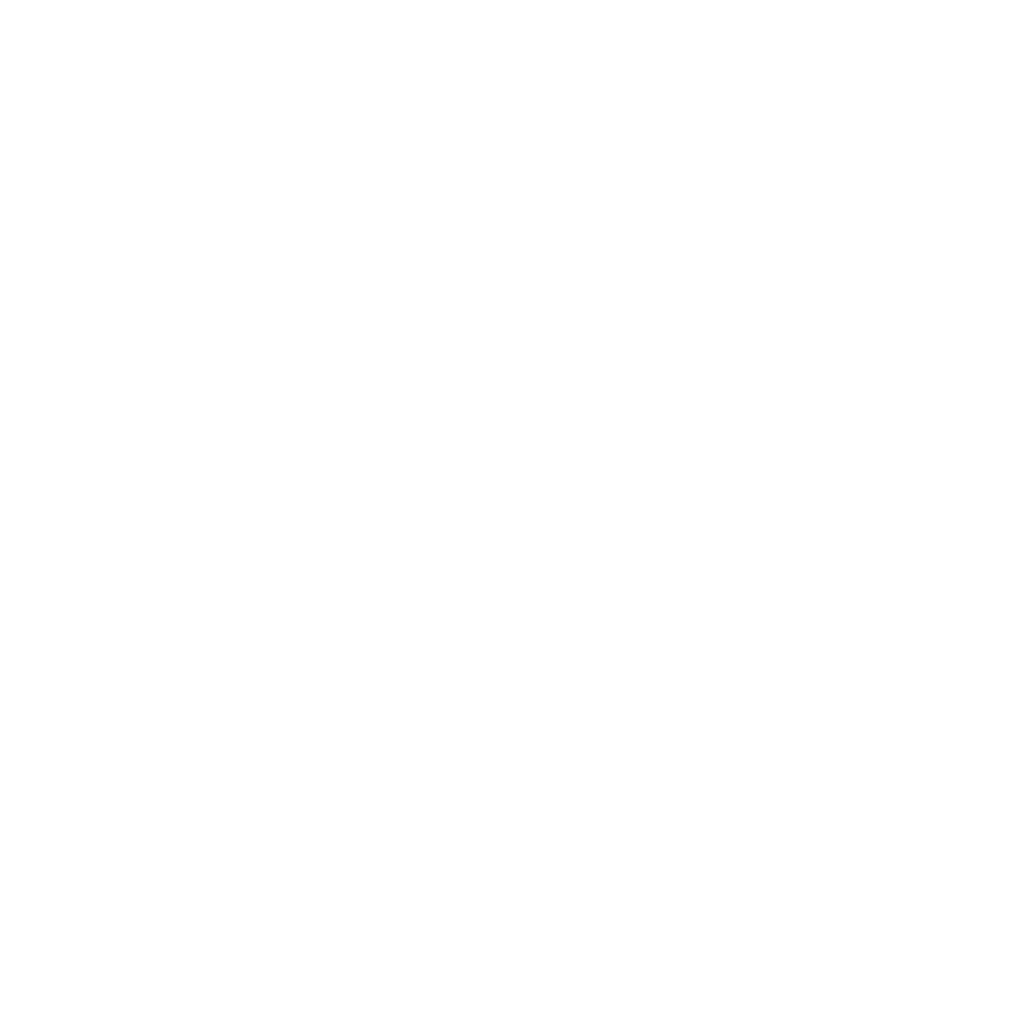Das Forschungsvorhaben „Ich hab das nicht akzeptiert! Jenische Widerstandspraktiken im Tirol des 20. Jahrhunderts“ untersucht die vielfältigen Formen des Widerstands der Jenischen gegen Diskriminierung und Marginalisierung in Tirol. Die Jenischen sind eine soziokulturelle Minderheit mit einer eigenen Sprache und Kultur, die traditionell semi-nomadisch lebte. Das Projekt verwendet einen integrativen und partizipativen Ansatz, der Oral History, systematische Archiv- und Quellenarbeit sowie hermeneutische Lektüre umfasst. Ziel ist es, historische Widerstandsformen zu dokumentieren und deren Einfluss auf das heutige Selbstverständnis der Jenischen Gemeinschaften zu untersuchen.
Forschungsstand und Forschungslücke
Die Forschung zu den Jenischen, einer soziokulturellen Minderheit in Mitteleuropa, die traditionell semi-nomadisch lebte, hat eine komplexe und oft belastete Geschichte. Während des Nationalsozialismus wurde die Forschung über die Jenischen stark durch die Ideologie der Rassenhygiene und rassenbiologische Studien beeinflusst. Diese pseudowissenschaftlichen Untersuchungen pathologisierten die jenische Kultur und unterstützten diskriminierende Maßnahmen, die tief in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hineinwirkten. Jenischen wurde Kriminalität und Asozialität zugeschrieben – eine Sichtweise, die die wissenschaftliche und gesellschaftliche Wahrnehmung der Jenischen über Jahrzehnte hinweg prägte.
Um die Jahrtausendwende begann eine neue, empathische Perspektive in der Wissenschaft Fuß zu fassen. Dies wurde maßgeblich durch den jenischen Autor und Aktivisten Romed Mungenast und andere Forscher wie Schleich (2018), Pescosta (2001) und Grosinger (2003) beeinflusst. Diese Forschungen fokussieren sich auf die kritische Aufarbeitung der Verfolgungs- und Diskriminierungsgeschichte der Jenischen, jedoch wurden widerständige Praktiken der Jenischen oft nur implizit behandelt. Eine Ausnahme stellt die Arbeit von Christian Neumann (2017) dar, die die Widerständigkeit der jenischen Kultur im Kontext ihrer sozialen und politischen Einflüsse diskutiert. Neumann betont die Entwicklung von Überlebensstrategien als Widerstandsform gegen Armut und soziale Disziplinierung.
Das gegenwärtige Forschungsprojekt zielt darauf ab, diese Forschungslücke zu schließen und durch systematische Untersuchung ein reichhaltiges und differenziertes Bild jenischer Widerstandspraktiken zu schaffen.
Forschungsvorhaben
Das Forschungsvorhaben „Ich hab das nicht akzeptiert! Jenische Widerstandspraktiken im Tirol des 20. Jahrhunderts“ verfolgt das Ziel, die verschiedenen Formen des Widerstands der Jenischen gegen Diskriminierung und Marginalisierung zu identifizieren und zu analysieren. Das Projekt basiert auf mehreren Forschungsfragen, die ein umfassendes Verständnis der widerständigen Praktiken ermöglichen sollen:
- Welche jenischen Widerstandspraktiken lassen sich im Tirol des 20. Jahrhunderts identifizieren?
Um diese Frage zu beantworten, wird ein mehrdimensionales Modell verwendet, das institutionelle, strukturelle, alltägliche und internalisierte Diskriminierungsformen berücksichtigt. Es soll herausgearbeitet werden, welche traditionellen Praktiken und kulturellen Ausdrucksformen der Jenischen in Tirol ihr widerständiges Verhalten beeinflussten. - Wie interagieren jenische Widerstandsformen mit der mehrdimensionalen Diskriminierung und Verfolgung?
Diese Frage zielt darauf ab, die Wechselwirkungen zwischen historischen Zäsuren, gesellschaftlichen Veränderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen im Tirol des 20. Jahrhunderts und den widerständigen Praktiken der Jenischen zu untersuchen. Es wird analysiert, ob jenisches Gegenverhalten defensiv oder proaktiv war. - Welche Rolle spielen widerständige Praktiken in der Identität heutiger Jenischer?
Hier wird der Einfluss historischer Widerstandsformen auf das Selbstverständnis der heutigen jenischen Gemeinschaft untersucht. Es wird analysiert, ob sich heutige Jenische in einer historischen Widerstandstradition verorten.
Das Forschungsprojekt verwendet einen integrativen methodischen Ansatz, der Oral History, systematische Archiv- und Quellenarbeit sowie hermeneutische Lektüre kombiniert. Dieser Ansatz ermöglicht es, ein reichhaltiges Bild der Widerstandspraktiken Jenischer im Tirol des 20. Jahrhunderts vor dem Hintergrund multidimensionaler Diskriminierung und Marginalisierung zu zeichnen, ohne dabei ein jenisches Kollektivsubjekt zu konstruieren.
Institutionelle Diskriminierung
Institutionelle Diskriminierung umfasst Praktiken der Herabsetzung, Benachteiligung und Ausgrenzung von sozialen Gruppen auf der Ebene von Organisationen und ihren Professionen, die zu dauerhaften Benachteiligungen führen. Diese Diskriminierung begann lange vor der nationalsozialistischen Diktatur und setzte sich auch nach 1945 fort. Beispiele dafür sind die strategischen Maßnahmen des Gesetzgebers gegen das Umherziehen der Jenischen im Jahr 1853 und die fortgesetzte polizeiliche, justizielle und administrative Benachteiligung der Jenischen nach dem Zweiten Weltkrieg.
Alltagsdiskriminierung
Alltagsdiskriminierung beschreibt subtile und alltägliche Praktiken der Diskriminierung, mit denen Mitglieder marginalisierter Gruppen konfrontiert sind. Beispiele dafür sind herabwürdigende Bemerkungen oder die Verunglimpfung aufgrund von Familiennamen. Diese Formen der Diskriminierung führen oft zur Verinnerlichung und Akzeptanz negativer Zuschreibungen.
Internalisierte Diskriminierung
Internalisierte Diskriminierung tritt auf, wenn Mitglieder marginalisierter Gruppen die ihnen zugeschriebenen negativen Stereotypen in ihr eigenes Selbstbild integrieren. Dies kann zu Verhaltensweisen entlang dieser Zuschreibungen führen und als selbsterfüllende Prophezeiung wirken.
Das Forschungsdesign betont die Bedeutung partizipativer Elemente, indem Jenische als Co-Forscher:innen aktiv in den Forschungsprozess eingebunden werden. Diese Co-Forscher:innen werden geschult und führen Interviews durch, um die Qualität der gesammelten Daten zu gewährleisten. Zwischenergebnisse werden regelmäßig reflektiert und mit der jenischen Gemeinschaft diskutiert, um valide und akzeptierte Analysen zu ermöglichen.
Durch die Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck wird die wissenschaftliche Qualität des Projekts sichergestellt. Der partizipative Ansatz soll nicht nur neue Erkenntnisse gewinnen, sondern auch positive Veränderungen anstoßen und die Selbstermächtigung der Jenischen Gemeinschaft fördern.
Ethische Aspekte
Das Forschungsprojekt verpflichtet sich den Fairness-Regeln für Forschende und Kulturschaffende der Radgenossenschaft der Landstraße. Jenische werden nicht nur als Objekte der Forschung, sondern als aktive Mitgestalter:innen einbezogen. Ethische Richtlinien beinhalten Respekt und Sensibilität, informierte Zustimmung, Anonymität und Vertraulichkeit, partizipative Ethik, kontinuierliche Reflexion ethischer Herausforderungen sowie Transparenz und Verantwortlichkeit.
Kooperationspartner
Zu den Kooperationspartnern zählen das Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck, das Tiroler Landesarchiv, das Stadtarchiv Innsbruck, das Historische Archiv des Landeskrankenhauses Hall, die Bibliothek des Ferdinandeums, der Verein Jenische in Österreich, der Europäische Jenische Rat, die Radgenossenschaft der Landstraße, der Zentralrat der Jenischen Deutschland sowie der Jenische und Wissenschaftliche Beirat des Jenischen Archivs.
Projektplan und Arbeitspakete
Das dreijährige Projekt ist in verschiedene Phasen unterteilt:
- Jahr 1: Einführung und Schulung der Co-Forscher:innen, Beginn der Datensammlung (Oral History Interviews, Archivrecherchen, Analyse wissenschaftlicher Literatur).
- Jahr 2: Datenanalyse und Reflexionsschleifen, Ergänzung des Materials, Interpretation und Zusammenstellung der Ergebnisse.
- Jahr 3: Erstellung des Forschungsberichts, Vorbereitung und Durchführung der Dissemination, Abschlussbewertung und langfristige Planung.
Nachhaltigkeit und langfristige Planung
Es werden Strategien für die langfristige Nutzung und Verbreitung der Forschungsergebnisse entwickelt. Zukünftige Projekte oder Fortsetzungen werden in Betracht gezogen, um die gewonnenen Erkenntnisse nachhaltig zu nutzen und weiterzugeben.
Veröffentlichungen und Tätigkeiten des Jenischen Archivs
Das Jenische Archiv, gegründet von der Initiative Minderheiten Tirol, dient als zentraler Ort des Forschens und Erinnerns. Es zielt darauf ab, das kulturelle Gedächtnis der Tiroler Fahrenden zu bewahren und für zukünftige öffentliche und wissenschaftliche Auseinandersetzungen zugänglich zu machen. Über die etablierten Netzwerke werden Jenische und andere Interessierte aktiv zur Beteiligung eingeladen, um das verstreute Wissen zu bündeln und der Institution zur Verfügung zu stellen.
Das Forschungsprojekt trägt dazu bei, die historische und kulturelle Identität der Jenischen in Tirol zu bewahren und sichtbar zu machen. Es fördert ein besseres Verständnis und eine höhere Sichtbarkeit der Jenischen und ihrer Kultur in der modernen Gesellschaft, indem es ihre widerständigen Praktiken dokumentiert und analysiert.
Das Projekt wird gefördert von der Kulturabteilung des Landes Tirol – Schwerpunkt Erinnerungskultur und vom Kulturamt der Stadt Innsbruck.